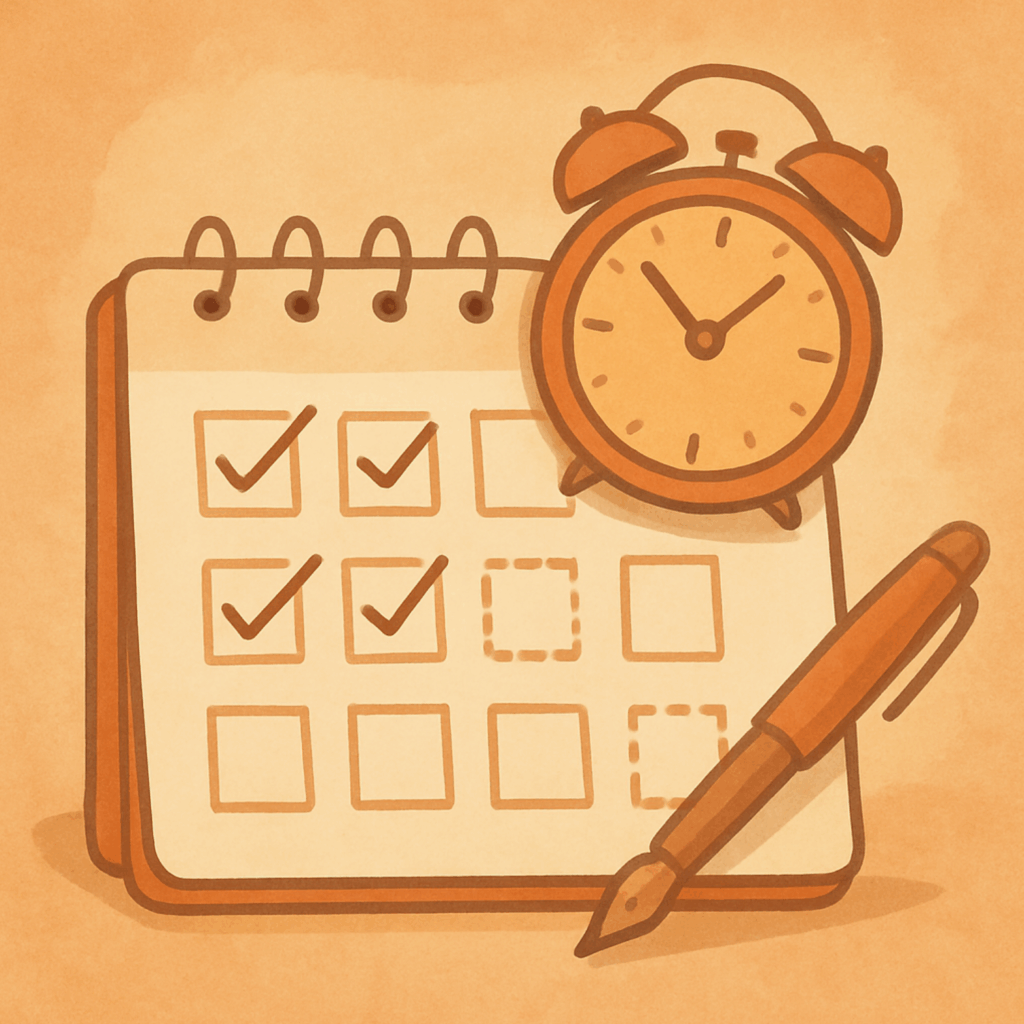(Un-)Verbindlichkeit von Studierenden bei Schlüsselkompetenzveranstaltungen – darum ging es diese Woche bei einem Termin der Reihe „Schlüsselkompetenzen im Diskurs“ der Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen. Ich durfte die Veranstaltung moderieren; der Input kam von Dr. Johann Fischer, Leiter der Zentralen Einrichtung für Sprachen und Schlüsselqualifikationen der Uni Göttingen. Eine Randbemerkung vorab: Nicht nur Studierende sind seit der Corona-Pandemie wesentlich unverbindlicher – auch Lehrende und Hochschulmitarbeitende sind es. Zum einen haben sich nur 11 Personen für den Termin angemeldet, was wirklich nicht viel ist. Zum anderen kamen von diesen 11 Personen nur sechs Personen. Wie war das noch gleich mit dem Glashaus und dem Werfen von Steinen?
Johann Fischer zeigte zunächst in einem Input Ergebnisse einer kleinen Erhebung bei sich an der Uni und stellte dabei pointiert die strukturellen Verschiebungen seit der Corona-Pandemie auf. Die Buchungen gehen zurück, die Teilnehmenden erscheinen nicht trotz Anmeldung, Kurse fallen aus aufgrund einer zu geringen TN-Zahl. Das ist keine neue Erkenntnis, aber es wird immer spürbarer. Kurse, die früher in zwei Tagen voll waren, haben jetzt, zwei Wochen nach Start der Vorlesungszeit noch freie Plätze. Manche laufen zwar offiziell, aber es kommen dann deutlich weniger als angemeldet. Und manche müssen wir ganz absagen, weil sich zu wenige anmelden. Für alle Beteiligten ist das frustrierend – organisatorisch, finanziell, didaktisch.
Besonders frustrierend ist: Selbst bei Themen wie KI, bei denen wir dachten, dass gerade da ein Run entsteht, bleiben die Teilnehmenden aus. Wir haben in den letzten Monaten viele neue Formate zu KI ins Programm genommen. Mit Praxisbezug, mit Tools, mit konkreten Anwendungsfällen fürs Studium – trotzdem: vereinzelt Anmeldungen, selten ausgebucht, manchmal kurzfristige Absagen. Online, hybrid, Präsenz – das Muster ist überall ähnlich.
Wir haben dann versucht, gemeinsam zu sortieren, woran es liegen könnte. Die Vermutungen:
- Individuelle Lebensrealitäten: Viele Studierende jonglieren Studium, Nebenjob, Familienverantwortung, psychische Belastungen. Ein Seminar ist da nicht automatisch ein gesetzter Termin, sondern eher ein Angebot unter vielen. Wer da einen freiwilligen Kurs aus dem überfachlichen Bereich gebucht hat, priorisiert ihn im Zweifel zuletzt.
- Selbststeuerung: Die Flexibilisierung des Studiums bringt mit sich, dass Studierende sehr kurzfristig entscheiden – und sich auch kurzfristig umentscheiden.
- Wert der Teilnahme: Wenn keine klaren Anreize (z. B. ECTS, Leistungsnachweise, Zertifikate) gesetzt sind, fehlt manchmal einfach der Grund zu kommen – oder zu bleiben. Wobei das selbst dann, wenn es ECTS gibt, nicht unbedingt anders aussieht.
Natürlich haben wir auch über Lösungsansätze gesprochen – viele davon pragmatisch und niedrigschwellig: eine persönliche Reminder-Mail vor Veranstaltungsbeginn, ein klarer, transparente Kommunikation zum Format, hybride Optionen. Andere Ideen zielen stärker auf strukturelle Veränderungen ab: gut gestaltete Lernräume (Stichpunkt ‚sticky campus‘), Blended-Learning-Konzepte, langfristige Gruppenprojekte mit Feedbackkultur, bei Veranstaltungen mit mehreren Terminen zum Ende eines Termins ‚Cliffhanger‘ für den nächsten Termin.
Und dann gab es noch die leisen Zwischentöne, die ich besonders wichtig fand: nicht in Aktionismus verfallen, keine Schnellschüsse – und vor allem kein Studierenden-Bashing (s.o.: Wer selbst im Glashaus sitzt …). Die Lebensrealitäten der Studierenden haben sich verändert – und das nicht erst seit Corona. Egal, wie viel wir machen, tun, ausprobieren, wir werden das nicht mehr rückgängig machen. Insofern erbrachte unser Austausch natürlich auch nicht DIE eine Patentlösung. Ich denke, es geht vor allem um eine Akzeptanz der neuen Realität und dann darum, mit dieser umzugehen. Was auch immer das dann konkret bedeuten mag …
Was mir im Nachgang zu unserem Austausch noch einmal bewusst wurde: Vielleicht liegt der eigentliche Denkfehler gar nicht (nur) darin, wie wir Angebote gestalten, bewerben oder strukturieren – sondern im zugrunde liegenden Bild, das wir von Studium und Lehre haben. Viele Schlüsselkompetenzangebote basieren implizit auf einem Modell von Studium, das sich an Vollzeit-Studierenden orientiert: zeitlich verfügbar, intrinsisch motiviert, engagiert, reflexiv, orientiert an langfristiger Kompetenzentwicklung (Sidenote: Gab es diese wirklich jemals (seit Bologna)?). Kurz: an einer idealisierten Figur, die es so in der Realität immer seltener gibt.
Aber was, wenn diese Figur nicht mehr der Maßstab ist? Was, wenn wir es heute mit einem ganz anderen Studierendentypus zu tun haben – nicht weniger interessiert oder intelligent, aber mit deutlich weniger freier Zeit, mehr mentaler Belastung, weniger institutioneller Bindung? Dann helfen Reminder-Mails oder niedrigschwellige Formate nur bedingt. Dann müssten wir eigentlich grundlegend neu denken, wie überfachliches Lernen im Studium stattfinden kann – und zwar jenseits von 90-Minuten-Terminen mit optionaler Teilnahme. Die Debatte über Future Skills muss also nicht nur inhaltlich geführt werden („Welche Kompetenzen brauchen Studierende?“), sondern auch strukturell: Wo und wann kann überfachliches Lernen überhaupt sinnvoll stattfinden? Und unter welchen Bedingungen lohnt es sich für Studierende, überhaupt zu investieren?
Mir scheint: Wir bewegen uns gerade in einem Spannungsfeld zwischen einem Anspruch, den viele von uns (zurecht) nicht aufgeben wollen – Persönlichkeitsbildung, Reflexion, Transferfähigkeit – und einem Studienalltag, der dafür kaum mehr Räume lässt. Das frustriert. Und es macht angreifbar, weil unsere Angebote so leicht den Stempel „nice to have“ bekommen. Was es braucht, ist wahrscheinlich weniger Innovation und mehr Ehrlichkeit. Weniger Projektmittel für neue Pilotformate, mehr strukturelle Diskussion über Platz, Relevanz und Anerkennung überfachlicher Bildung. Und vielleicht auch mehr Mut zur Lücke: nicht alles aufrechterhalten zu wollen, was mal gut war – sondern Dinge bewusst loszulassen, die einfach nicht mehr funktionieren.