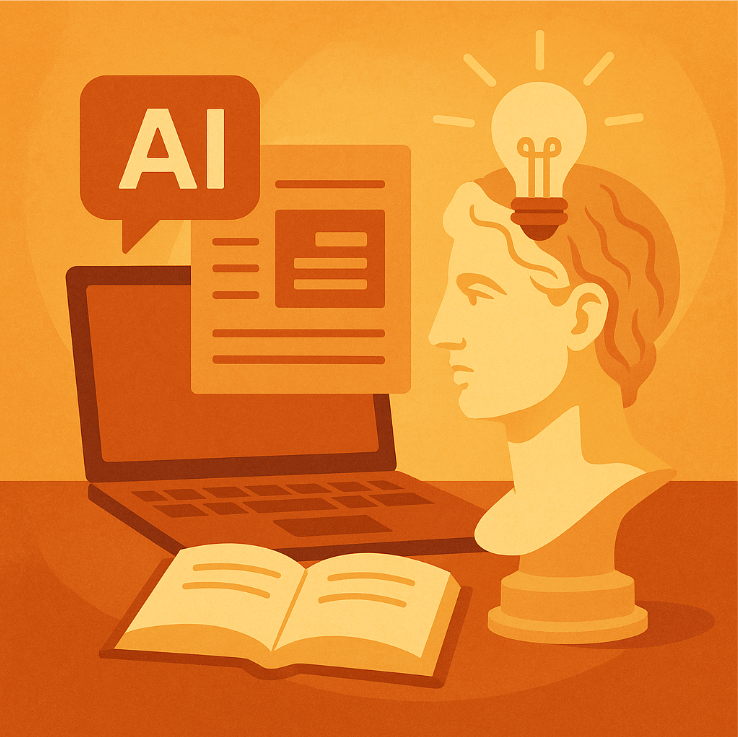Urlaubsbedingt fällt der heutige Blogpost eher kurz aus. Ich möchte zum einen auf einen Blogpost von Nele Hirsch hinweisen und zum anderen noch von einem Vortrag berichten, bei dem ich vor meinem Urlaub war.
Nele Hirsch hat kürzlich in diesem Blogpost ihren eigenen Lernweg zur Entwicklung von KI-gestützten Mini-Apps für die Lehre reflektiert und zwar in fünf Schritten. Ausgangspunkt war ihre anfängliche Faszination für „Helfer-Tools“ (das eigene Bauen von Tools zur Unterstützung der Lehre, etwa für zufällige Gruppeneinteilungen oder für Kreativitätsbooster), die sie selbst per Prompt bauen konnte. Doch spannend wird es da, wo sie beschreibt, wie sich ihr Blick vom Lehren zum Lernen verschoben hat: Weg vom reinen Tool-Basteln hin zu Anwendungen, die Resonanzräume schaffen, Reflexion ermöglichen und soziale Lernprozesse unterstützen. Besonders inspirierend finde ich ihre Unterscheidung zwischen „intelligenten“ Apps und „resonanzreichen“ Apps: Es geht nicht um ein weiteres Chatbot-Interface, sondern um kluge Impulse, die den eigenen Denkraum erweitern. Sie schreibt, dass es letztlich darum gehen sollte, Lehrende selbst dazu zu befähigen, in die Lage zu kommen, eigene Tools für ihr Lernen zu entwickeln, zu reflektieren und dabei selbstbestimmt mit KI umzugehen. Wer darüber nachdenkt, wie Lernen und KI sinnvoll zusammenkommen können, sollte diesen Blogpost von Nele wirklich lesen, weil er eine andere Perspektive auf Lehren und Lernen mit KI aufzeigt: Nicht wir als Lehrende entwickeln KI-Tools für unsere Lernenden (auch wenn man hier ganz viel machen kann!), sondern wir als Lehrende sollten Lernende dazu befähigen, dass sie sich selbst solche KI-Tools für ihr eigenes Lernen entwickeln können.
Außerdem möchte ich noch, wie angekündigt, von einem Vortrag berichten, bei dem ich war. Im Rahmen der Reihe Artificial Friday stellte Katrin Lehnen (Gießen) am 06.06. zentrale Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit kollaborativen Schreibpraktiken im Kontext generativer KI vor. Im Zentrum stand die Frage, wie Rollen- und Kooperationskonzepte beim Schreiben mit KI entstehen (Steinhoff/Lehnen 2025) und welche Implikationen dies für Lern- und Schreibprozesse in der Hochschullehre hat.
Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass Studierende Dialoge mit ChatGPT oft in einer Weise beschreiben, die an zwischenmenschliche Kommunikation erinnert. Die Zuschreibung von Intentionalität („hat verstanden, was ich sagen wollte“), das Erleben von Bestätigung und der Impuls, sich bedanken zu wollen, zeigen, dass KI-Interaktionen als sozial eingebettete Prozesse wahrgenommen werden. Dabei bleibt jedoch eine Ambivalenz bestehen: Die bewusste Reflexion darüber, dass es sich um eine Maschine handelt, wird zugleich artikuliert.
Lehnen ordnete diese Beobachtungen theoretisch mit Hilfe des GPT-Modells ein, das sie gemeinsam mit Thorsten Steinhoff entwickelt hat. Das Modell unterscheidet drei Rollen, die KI beim Schreiben einnehmen kann: Ghost, Tutor und Partner. Entsprechend ergeben sich korrespondierende Rollen für die Nutzer:innen als Auftraggebende, Lernende oder Kollaborierende. Diese Differenzierung ermöglicht eine präzisere Analyse und didaktische Gestaltung von Schreibprozessen mit KI.
Ein weiterer Fokus des Vortrags lag auf der Analyse der Benutzeroberflächen von KI-Systemen wie ChatGPT. Lehnen zeigte auf, dass die Interaktion mit generativer KI durch die Gestaltung der Interfaces stark gerahmt wird: Gesprächseröffnungen („Wie kann ich dir helfen?“), kontinuierliches Backchanneling („Gute Frage“, „Natürlich, hier ist dein Text“) und personalisierte Anreden erzeugen eine quasi-interaktive Situation. Diese Interface-Elemente fördern eine Wahrnehmung von Prozesshaftigkeit und suggerieren Nähe sowie Koaktivität.
Lehnen verknüpfte diese Aspekte mit medien- und praxistheoretischen Perspektiven: Medienkonstellationen, die technische Infrastrukturen, Subjekte, Praktiken und Inhalte umfassen, prägen die Art und Weise, wie Schreiben und Interaktion mit KI stattfinden. Dabei sind es nicht nur Funktionen der Textproduktion, sondern auch kommunikative Praktiken, die von den Systemen initiiert werden und Einfluss auf die Gestaltung des Schreibprozesses nehmen.
Hervorgehoben wurde außerdem, dass generative KI-Systeme zunehmend proaktive Impulse geben, um Nutzer:innen zur Kooperation einzuladen. Diese in die Programme eingeschriebene Proaktivität hat Einfluss darauf, wie Schreibprozesse initiiert und gestaltet werden und kann didaktisch genutzt werden, um Studierende zu einer reflexiven Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Rolle im Schreibprozess anzuregen.
Insgesamt machte der Vortrag deutlich, dass der Einsatz von KI beim Schreiben nicht nur als technischer Support verstanden werden sollte, sondern als Teil komplexer Interaktionsprozesse, die Rollen, Praktiken und Wahrnehmungen von Autor:innenschaft transformieren. Für die Hochschullehre ergeben sich daraus Anknüpfungspunkte für eine gezielte Reflexion über die Gestaltung von Schreibprozessen mit KI und die Entwicklung eines bewussten Rollenverständnisses im Umgang mit generativen Systemen.
Last but not least: Diese Woche erschien eine neue Folge des Podcasts „Education Minds“ von Yvo Wüest, wo ich zu Gast war und über mein Buch „Wissenschaftliches Schreiben mit KI“ sprechen konnte. Außerdem hat Yvo auch eine Rezension zu meinem Buch veröffentlicht. Wer sich den Podcast anhören möchte, kann das direkt hier tun oder bei Apple oder Spotify.