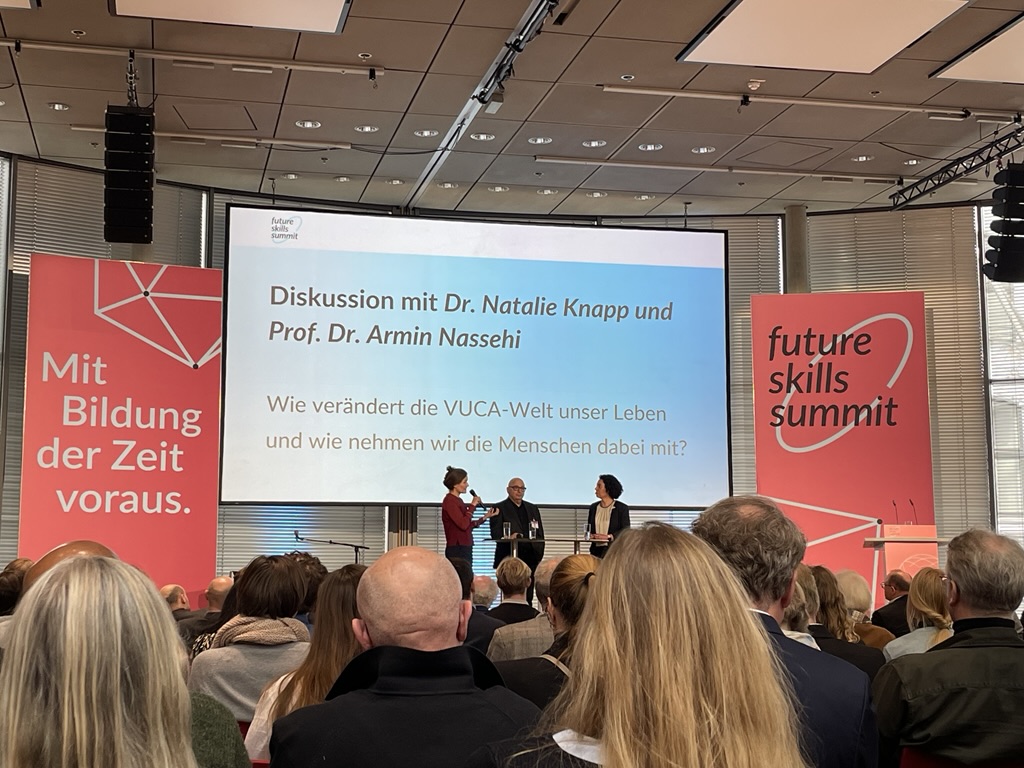Am 11./12.03. fand in Berlin der Future Skills Summit der Bertelsmann Stiftung unter Mitwirkung des CHE statt – eine Veranstaltung, die Akteur:innen über alle Bildungsbereiche hinweg zum Thema Future Skills zusammenbrachte. Neben den ‚üblichen Verdächtigen‘ sah ich auch ganz viele Gesichter, die ich noch nicht kannte, eben weil ich nicht wie sonst nur in meiner Hochschul-Bubble unterwegs war.
Für mich war direkt die Diskussion zu Anfang zwischen Armin Nassehi und Nathalie Knapp ein Highlight der Tagung. Ich hatte im Rahmen meiner Dissertation viel von Nassehi gelesen, der vor allem am Ende des letzten Jahrhunderts einiges im Bereich Thanatosoziologie publiziert hatte. Nach meiner Dissertation war ich immer wieder in verschiedenen Kontexten auf ihn gestoßen und so hat es mich sehr gefreut, ihn jetzt mal live zu erleben. Die Diskussion hatte als Ausgangspunkt die Frage, wie die VUCA-Welt unser Leben verändert und wie wir die Menschen dabei mitnehmen. Ich fand sehr spannend, dass direkt zu Beginn gesagt wurde, dass von der Wissenschaft immer Fakten erwartet werden, aber dass Wissenschaft eigentlich mit dem Infragestellen von Evidenzen beginnen muss. Dass Situationen, in denen Menschen schon von Vorneherein ganz genau wissen, wie etwas ist oder zu sein hat, genau das Teil des Problems sind. Nassehi setzte hier noch einen drauf und sagte, dass die Welt unter Kausalitis leide: Für alles wird eine Ursache gesucht und in allem werden Kausalitäten gesehen, auch wenn es nur Korrelationen gibt. Diese Punkte passten ganz gut zu zwei Büchern, die ich jüngst beendet habe. Das eine ist „Wahrheiten und Mehrheiten. Kritik des autoritäten Szentismus“ von Peter Strohschneider, bei dem es um naive Wissenschaftsgläubigkeit und die Frage geht, inwiefern Wissenschaft Wahrheit hervorbringt und deshalb die Politik informieren darf – oder eben nicht. Und das andere ist der Klassiker von Daniel Kahnemann, den ich nun endlich auch einmal gelesen habe „Schnelles Denken, Langsames Denken„, bei dem es auch ganz viel um das geht, was Nassehi als Kausalitis bezeichnet hat. Knapp stellte die These auf, dass für sie in einer Welt der permanenten Unsicherheit die zentrale Kompetenz sei, sich in seine eigene Sicherheit zurückzuführen. Dass man dem unangenehmen Gefühl von Unsicherheit begegnen kann, ohne ihm direkt die Suche nach kompletter Sicherheit entgegenzusetzen. Und so wurden die beiden Seiten der Medaille ‚Unsicherheit‘ beleuchtet: das Unangenehme und Verwirrende auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Tatsache, dass Unsicherheit auch ein wichtiges Ausgangsgefühl für kreative Akte sein kann, solange sie nicht in Angst umschlägt. Spannend fand ich, dass Knapp meinte, dass sie allen ihren Studierenden vor jedem Seminar die beiden Fragen an die Hand gibt „Was weiß ich absolut sicher?“ und „Was gibt mir Sicherheit?“ Und dann sollen die Studierenden eine Woche lang darüber nachdenken. Wenn sie wieder zusammenkommen, ist es immer so, dass die Studierenden sagen, dass das, was ihnen Sicherheit gibt, nicht das ist, was sie mit Sicherheit wissen. Es zeigt also, dass Sicherheit oft aus etwas anderem kommt als aus vermeintlich objektivem und vermeintlich sicherem Wissen. Nassehi und Knapp haben das Thema der VUCA-Welt schön mit Future Skills verbunden, indem sie die These aufstellten, dass es bei Future Skills auch um eine bestimmte Struktur des Denkens gehe. Weg von einfachen Wenn-Dann-Relationen denken, weg von Kausalitis, hin zum Aushalten von Unsicherheit, Ambiguitätstoleranz, Flexibilität.
Bei den Sessions am Nachmittag war ich in der Session „Future Skills im Curriculum – Herausforderungen, Chancen und Lösungen für die flächendeckende Verankerung von Zukunftskompetenzen in der Hochschullehre“. Zu Beginn gab es drei Impulse, einen von Evelyn Korn, die das MarSkills-Modul vorstellte, einen von Vera Gehrs, die ihre aktuelle Arbeit an der curricularen Verankerung eines Future-Skills-Moduls an der HS Osnabrück präsentierte, und einen von Wibke Matthes, die die Profillinien der CAU Kiel vorstellte.
Die Impulse, aber auch die Kommentare in der Diskussion drehten sich zum einen immer wieder um die Frage, ob Future Skills nicht alter Wein in neuen Schläuchen ist. Für Evelyn Korn zum Beispiel ist das, was mit Future Skills bezeichnet wird, einfach Bildung, das Grundwesen von Bildung. Zum anderen ging es wiederholt um die Thematik, dass Future Skills oft changieren zwischen ihrer neoliberalen Ausrichtung bzw. Verhaftung einerseits und ihrem produktiven, von einem bestimmten Werteverständnis getriebenen Empowerment zur Welt-Gestaltung andererseits.
An den drei Impulsen gefiel mir sehr gut, dass eigentlich alle den Fokus auf Herausforderungen der Implementierung von Future Skills ins Curriculum gelegt haben. Ich fand das deswegen schön, weil bei solchen Konferenzen in der Regel ja immer nur über Good Practices berichtet wird. Alle drei haben an ihren Hochschulen definitiv Good Practices vorzuweisen, aber Good Practices sind nicht von heute auf morgen da. Und das wurde hier sehr deutlich. Für mich war das Reden über Herausforderungen und über Probleme sehr ermutigend, weil es authentisch war und weil es eben den Blick auf die andere Seite der Medaille, die Frustrationen und Anstrengungen hinter den tollen Projekten, die alle drei an ihren Hochschulen im Bereich Future Skills geschafft haben, legte. So wurden als Probleme für die Integration von Future Skills ins Curriculum verschiedene Punkte diskutiert, zum Beispiel hierarchische Strukturen, systemische Starrheit, mangelnde Flexibilität, fehlendes Commitment, unklare Perspektiven für Stellen gerade im Third Space, mangelnde Strategie, unklare Zuständigkeiten unzureichende Sichtbarkeit von Future Skills für Studierende, fachkulturelle Barrieren, fehlendes gemeinsames Verständnis davon, was Future Skills sind, geringes Bewusstsein unter Lehrenden, niedrige Selbstwahrnehmung bei Studierenden und mangelnde Strukturen, weil Future Skills quer zur Fachlogik liegen. Eine Frage war auch, ob Studierende wissen müssen, was unter Future Skills zu verstehen ist und wie sie dieses Konstrukt in Bezug auf ihr Fachstudium einordnen sollen. Ich fand das Fazit von Wibke Matthes sehr interessant, in dem sie sagte, dass die Universalität von Future Skills ihnen in einer Welt der immer zunehmenden Spezialisierung zum Verhängnis wird.
Die Organisator:innen vonseiten des CHE hatten im Voraus schon eine Art Modell von Gelingensbedingungen bzw. Ansatzpunkten für die Implementation von Future Skills im Curriculum erstellt, was während des Workshops ergänzt wurde. Nach den Inputs fanden wir uns in vier Ideenwerkstätten zusammen, die sich mit den vier Dimensionen des Modells „Sollen“, „Dürfen, „Können“ und „Wollen“ beschäftigten. Die Frage war jeweils: „Damit das Können/Wollen/Dürfen/Sollen funktioniert, muss Folgendes passieren …“. Von den vier Gruppen wurden jeweils sehr viele Stichpunkte zusammengetragen und ich bin sehr gespannt, wie das CHE das aufbereiten wird.
Als Abschlussinput reisten Ulf Daniel Ehlers und Laura Eigbrecht noch in 15 good practices um die Future Skill-Welt. Eine tolle Idee für einen Impuls! In jeweils einer Minute wurden 15 Beispiele (Inland und Ausland) vorgestellt, in denen Future Skills vorbildhaft gefördert werden. Ich persönlich möchte mich im Nachgang besonders mit der 42er Coding School, freiform.org der Fachhochschule Nordschweiz und dem Modul-o-mat der DHBW CAS beschäftigen.
Tag 2 begann für mich mit einem Workshop, der ein Thema in den Fokus rückte, um das es bislang noch kaum bis gar nicht gegangen war: KI. Eines meiner zentralen Takeaways des Future Skills Summit ist für mich daher auch die Beobachtung, dass Future Skills und KI kaum zusammen gedacht wurden. Das hat mich enorm überrascht! In den Sessions, die ich am ersten Tag besuchte, kam das Wort „KI“ nur zweimal vor – einmal, weil ich es in einem Redebeitrag erwähnte, und einmal, weil ein anderer diesen Wortbeitrag von mir aufgriff. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der ganze Summit direkt bei der Eröffnung eingeleitet wird von Plattitüden wie „jetzt, wo genKI da ist, sind Future Skills doch so wichtig wie nie zuvor“. Es gab aber nichts dergleichen. Und auch bei der Abschlussdiskussion wurde kein einziges Mal auf KI referiert.
Das Konzept des Workshops „KI und Future Skills“ hat mir sehr gefallen: In Kleingruppen arbeitete man an Praxisstationen und musste innerhalb von 15 Minuten mithilfe eines KI-Tools eine von fünf Aufgaben lösen und anschließend reflektieren, welche Kompetenzen man bei der KI-Nutzung einsetzte. Ich habe dabei zum ersten Mal ein Excel-Sheet von ChatGPT aufbereiten lassen und habe somit mal wieder etwas Neues mit ChatGPT gemacht. Die eingesetzten Kompetenzen wurden auf einem Miro-Board festgehalten, das von einer der Workshopleitenden dann als PDF exportiert und dann mittels Gamma in ein Slidedeck für den abschließenden Austausch im Plenum überführt wurde. Eine coole Idee, um Ergebnisse aus Gruppenarbeiten zusammenzuführen! Insgesamt blieb die Diskussion um Future Skills und KI aber leider eher oberflächlich – gerade zu dem Thema hätte ich mir einen viel tieferen Austausch gewünscht, aber das ist natürlich mein ganz individueller Background. Florian Rampelt schloss den Workshop mit dem Verweis auf ein paar KI- und Future Skills-Frameworks ab. Dabei rief er bei mir wieder die sieben KI-Kompetenzarten der Bertelsmann-Stiftung in Erinnerung, die ich irgendwann mal gesichtet, dann aber wieder vergessen habe, und die ich sehr brauchbar finde. Außerdem nahm er Bezug auf das TUCAPA-model von Laupichler et al. (2023). Zwar kannte ich auch dieses Paper, doch war mir das TUCAPA-model nicht explizit ein Begriff. Dabei ist es super handlich und fasst die drei zentralen KI-Kompetenzdimensionen perfekt zusammen: Technical Understanding, Critical Appraisal, Practical Application.
Aus dem letzten Workshop, den ich besuchte, konnte ich für meine eigene Arbeit eher weniger mitnehmen. Der Workshop stand unter dem Titel „Weiterbilden für die Zukunft – geht das?“ und im Kern ging es um die betriebliche Fort- und Weiterbildung. Gemäß dem Motto „man nimmt immer etwas mit“ habe ich aber auch hier einen Impuls aufgeschnappt, der sich aus einer eher scherzhaften Randnotiz aus dem Plenum ergab: und zwar die Frage nach einer Art ‚Shownotes‘ für Vorträge. Bei Podcasts bin ich es gewohnt, dass ich alle Informationen zu Studien & Co. in den Shownotes finde und sie nach Belieben vertiefen kann. Bei Vorträgen auf einer Konferenz bekommt man am Ende häufig nicht mal die Slides. Daher nehme ich mir für die Zukunft vor, ‚Shownotes‘ für meine Vorträge auf Konferenzen zu gestalten und z. B. auf jede Slide einen QR-Code mit einem Link zu platzieren, wo man die Slides und ggf. Zusatzmaterialien zum Download findet.
Die Podiumsdiskussion am Ende des Summit stand schließlich unter der Frage „Welche Veränderungsprozesse müssen wir anstoßen, um Future Skills lebenslang zu fördern und Menschen fit zu machen für Zukunft?“. Auf dem Panel saßen Personen mit unterschiedlichen Parteibüchern (Grüne, SPD, CDU) – und eine Abiturientin. Leider ging es in der Diskussion recht schnell nur noch um die Institution Schule und um die Frage der Validität von Noten, was sehr schade war. Als zentralen Impuls nehme ich für mich aber den Gedanken mit, dass Lehrformen implizit auch demokratiefördernd bzw. nicht demokratiefördernd sein können. Die klassische ‚Frontalbeschallung‘ mit vorgegebenen Inhalten sollte auch deshalb weitgehend der Vergangenheit angehören, da sie Lernende entmündigt. Selbstgesteuertes Lernen und die Aushandlung des Lerninhaltes und der Lernweise können zumindest indirekt demokratiebildend sein (danke an Leonie Wingerath für diesen Impuls).
Insgesamt waren die zwei Tage sehr schön, inspirierend und von vielen guten Gesprächen am Kaffeetisch geprägt. Danke dafür!