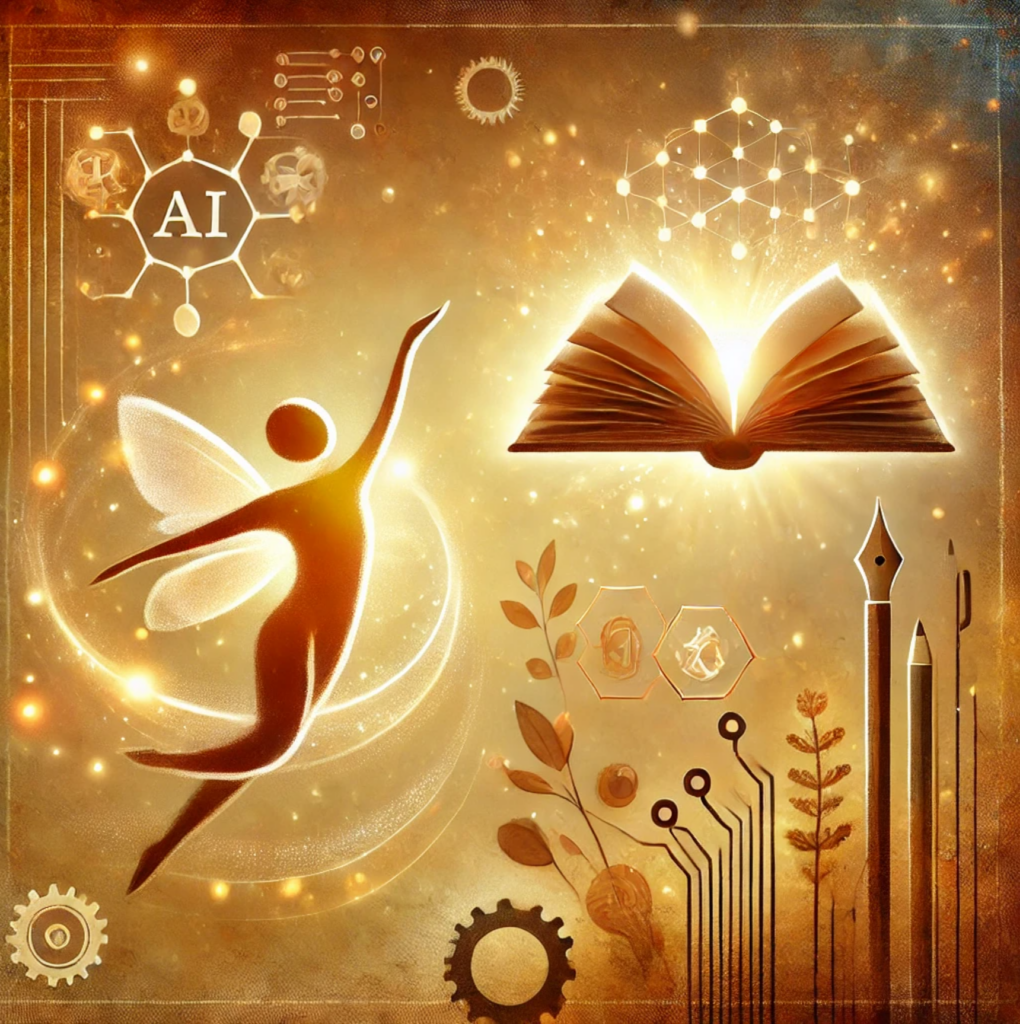Freudentänze und Glücksgefühle Anfang der Woche: Am Montag ist endlich mein Ratgeber-/Lehrbuch „Wissenschaftliches Schreiben mit KI“ erschienen. Vor genau einem Jahr bin ich in dieses Buchprojekt gestartet, immer im Wissen, dass das Ganze angesichts der enormen Dynamik bei dem Thema recht fix über die Bühne gehen muss. Ich würde sagen, dass mir das gelungen ist – acht Monate Schreibzeit, ca. vier Monate Druckfahnenüberarbeitung & Druck und fertig war das Buch. Wie kaum zu vermeiden war, gibt es natürlich schon jetzt überholte Angaben im Buch: So konnte ich z. B. beim Kapitel zum Prompting nicht mehr auf das veränderte Prompten für Deep Reasoning-Modelle eingehen. Aber die überarbeitete Auflage kommt bestimmt 🙂
Leider gab es am Montagabend keine ausgiebige Release-Party, da ich in einem Hotel im hessischen Niemandsland (aka an der Rhön) saß, wo ich an einer zweitägigen Fortbildung zum Thema „Führen in unsicheren Zeiten“ teilgenommen habe. Wie so häufig bei Fortbildungen im Kontext von Mitarbeiter:innen-Führung war es auch hier so, dass vieles von dem, was empfohlen wurde, ganz ‚logisch‘ und lässt sich allein aus einem ‚gesunden Menschenverstand‘ ableiten. Da ich zum einen Modelle aber immer sehr schätze, um Inhalte besser kognitiv greifen zu können, und zum anderen aus Fortbildungen oft den sprichwörtlichen ‚Tritt in den Hintern‘ mitnehme, bin ich froh, dass ich die Fortbildung besucht habe. Diesen Blogbeitrag nutze ich, um meine zentralen Learnings zusammenzutragen.
Ganz zentral habe ich mitgenommen, dass Veränderungen immer Reibungen und ggf. auch Konflikte erzeugen – egal, wie gut man sie vorbereitet und egal, wie gut man sie kommuniziert. Die widerstrebenden Kräfte finden sich daher auch in allen Modellen, die wir kennengelernt haben, sei es das 3-Phasen-Modell nach Lewin (unfreeze-change-refreeze), das Haus der Veränderung, den Haufe-Quadrant, das Modell nach Kübler-Ross/Streich oder das Modell nach Kotter. Verwirrung und Verlegung sind ganz normal in Veränderungsphasen und sollten auch nicht ‚übersprungen‘ werden. Natürlich muss der ‚Aufenthalt‘ in den Zimmern der Verwirrung und Verlegung irgendwann beendet werden, um wieder in die positive, gestaltende Aktion zu kommen. Ein Weg durch das ‚Haus der Veränderung‘, der diese Zimmer überspringt, ist jedoch keine Option: Es gibt keine Abkürzung zur Erneuerung. Außerdem hat jeder Mensch sein eigenes Tempo: Regeln dazu, wie lange der Aufenthalt in den verschiedenen Zimmern dauern sollte, gibt es nicht.
Das Erste, was gerade in anstrengenden Phasen der Veränderung oft leidet, ist die interne Kommunikation, obwohl diese das wichtigste ist. Dies ist definitiv ein Punkt, den ich mir wieder neu ‚hinter die Ohren‘ schreiben möchte, denn auch bei mir leidet die Kommunikation mit meinem Team z. T. gerade dann, wenn es besonders stressig ist … (unabhängig von Veränderungen, sondern generell). Mittels eines entsprechenden kommunikativen Verhaltens lässt sich auch in unsicheren Zeiten Sicherheit vermitteln. Dabei sind die Bedürfnisse nach Vorhersehbarkeit, Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit gerade in unsicheren Zeiten besonders relevant. Hier haben wir in der Fortbildung über verschiedene Optionen diskutiert, diese Bedürfnisse von Mitarbeitenden zu erfüllen.
Auf das Konto ‚Sicherheit trotz Unsicherheit‘ zahlt auch ein, am Anfang eines Change Prozesses immer das Warum und damit eine Change Story zu platzieren: Weshalb kann nicht alles bleiben wie bislang? Was wird passieren, wenn wir die Veränderung nicht vornehmen? So wird ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt und man kann Bündnisse schaffen. Gleichzeitig geht es darum, eine positive Zukunft zu entwerfen. Dabei ist immer wieder die Frage zu beantworten, was eigentlich jede einzelne Person aus dem Team davon hat, die Veränderung mitzugehen und mitzutragen. Warum lohnt es sich, das Ziel zu erreichen? Gemeinsamer Nenner aller Modelle ist der Punkt des Vertrauens.
Ich hatte schon öfter vom PERMA-Lead-Modell gelesen, mich aber noch nie näher damit beschäftigt. Daher war es schön, dass dieses im Kontext von Positive Leadership stehende Modell zumindest am Rande thematisiert wurde. Hier möchte ich mir besonders das M herauspicken (Meaning: Sinn in der Arbeit vermitteln). In diesem Rahmen spielte auch Selbstwirksamkeit eine Rolle: Wie schafft man es als Führungskraft, dass die Menschen, die man führt, das Gefühl haben, ihr Handeln würde wirklich einen Unterschied machen?
Zum Thema „Führung” habe ich Ende der Woche, also unabhängig von meiner Fortbildung, noch einen für mich sehr spannenden Impuls gefunden. „Neue Narrative“, deren Arbeit ich ohnehin sehr schätze und immer wieder als bereichernd erlebe, hat auf LinkedIn das Modell der „8 Leadership Hüte“ nach Robert Quinn vorgestellt. Hier wird zwischen acht verschiedenen Rollen differenziert, die man als Führungskraft einnehmen kann. Ich zitiere aus dem LinkedIn-Post:
- Innovations-Hut: Neue Ideen & Veränderungen vorantreiben
- Produktivitäts-Hut: Effizient & ergebnisorientiert
- Struktur-Hut: klare Regeln & Prozesse etablieren
- Monitor-Hut: Ergebnisse checken & Qualität sichern
- Moderations-Hut: Meetings & Entscheidungen leiten
- Coaching-Hut: Dein Team fördern & begleiten
- Strategie-Hut: Vision & Ziele vermitteln
- Vermittlungs-Hut: Dein Team sichtbar machen & vernetzen
„Neue Narrative“ wäre nicht „Neue Narrative“, wenn sie dazu nicht auch Reflexionsfragen stellen würden:
- Reflektiere deine aktuellen Rollen: Welche Hüte trägst du oft? Welche vernachlässigst du?
- Stimme dich mit deinem Team ab: Was erwarten sie von dir? Wo gibt es Lücken?
- Setze klare Prioritäten: Konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist.
Den Punkt der Abstimmung mit dem eigenen Team finde ich besonders spannend und werde ihn in den nächsten Wochen auf jeden Fall umsetzen.
Neben der zweitägigen Fortbildung habe ich mir diese Woche mal wieder mehr Zeit für Fachlektüre genommen als sonst. Vielleicht ist ja für den einen oder die andere Leser:in dieses Artikels eine interessante Publikation dabei:
„Creating Wicked Students“ von Paul Hanstedt (Buch): Der Autor plädiert dafür, Hochschulkurse so zu gestalten, dass sie Studierende auf die Bewältigung komplexer, sich ständig verändernder Probleme vorbereiten. Er betont, dass Studierende nicht nur Fachwissen erwerben, sondern auch die Fähigkeit entwickeln sollten, dieses Wissen kreativ und kritisch anzuwenden, um die Welt positiv zu beeinflussen. Hanstedt argumentiert, dass traditionelle Bildung häufig versagt, wenn es darum geht, solche „wicked competencies“ zu entwickeln, da sie sich zu sehr auf reines Faktenwissen und standardisierte Tests konzentriert. Insgesamt also nichts bahnbrechend Neues, trotzdem hat mir das Buch gefallen, nicht zuletzt aufgrund seines leichten Pathos. Spannend fand ich, dass Hanstedt nicht von studentischer Agency sprechen möchte, da ihm hier etwas fehle. Stattdessen spricht er von „authority“. Hierbei geht es ihm darum, dass Studierende authorship haben, die Fähigkeit zu schreiben und umzuschreiben, Neues zu formen und zu schaffen. Hanstedt bringt die Quintessenz seines Buches auf die Formel „Content Knowledge plus Skill Knowledge plus Sense of Authority is Thoughtful Change”.
„Disruptionsnarrative im aktuellen KI-in-Lehre-und-Studium-Diskurs: ein heuristischer Ordnungsversuch“ (Artikel ZfHE). Die Autorin Susanne Müller-Lindeque identifiziert aus der deutschsprachigen Literatur seit dem Launch von ChatGPT drei Narrative: das technozentrische Fortschrittsnarrativ: „Alles ist möglich, wenn man auf der Höhe der Zeit bleibt“, das reflexive Gestaltungsnarrativ: „Es liegt in unserer Hand …!“ und das akademische Verlustnarrativ „Wozu sind wir hier …?
„Selbstbestimmtes Handeln mit KI in der Hochschule: Forschungsdefizit und -perspektiven“ (Artikel ZfHE): „In diesem Text wollen wir zum einen zeigen, inwiefern ein Forschungsdefizit zu Risiken für ein selbstbestimmtes Handeln infolge von KI in der Hochschule vorliegt, und zum anderen ausführen, welche alternativen Forschungsperspektiven die derzeit favorisierte empirische Forschung ergänzen könnten.“ Die hier aufgezeigten Forschungsperspektiven für ein theoretisches Vorgehen fand ich sehr spannend und war etwas traurig darüber, dass die Perspektiven nur aufgezeigt wurden, aber noch keine konkreten theoretischen Überlegungen erfolgten.
Zum Schluss noch ein Hinweis, den ich im Template des Sammelbandes der kommenden dghd-Tagung gefunden habe und über den ich sehr entzückt war, weil ich davon noch nie gehört hatte: „Ob für eine Publikation ein DOI vorhanden ist, können Sie kostenfrei überprüfen unter https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery. Dazu kopieren Sie Ihr Literaturverzeichnis in das Textfeld und klicken auf „Submit“. Das Online-Tool liefert daraufhin ein um DOIs erweitertes Verzeichnis.“